Akteur*innen und Aufgaben
An der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle sind eine Vielzahl von Akteuren beteiligt. An dieser Stelle stellen wir Ihnen die wichtigsten Akteur*innen vor.
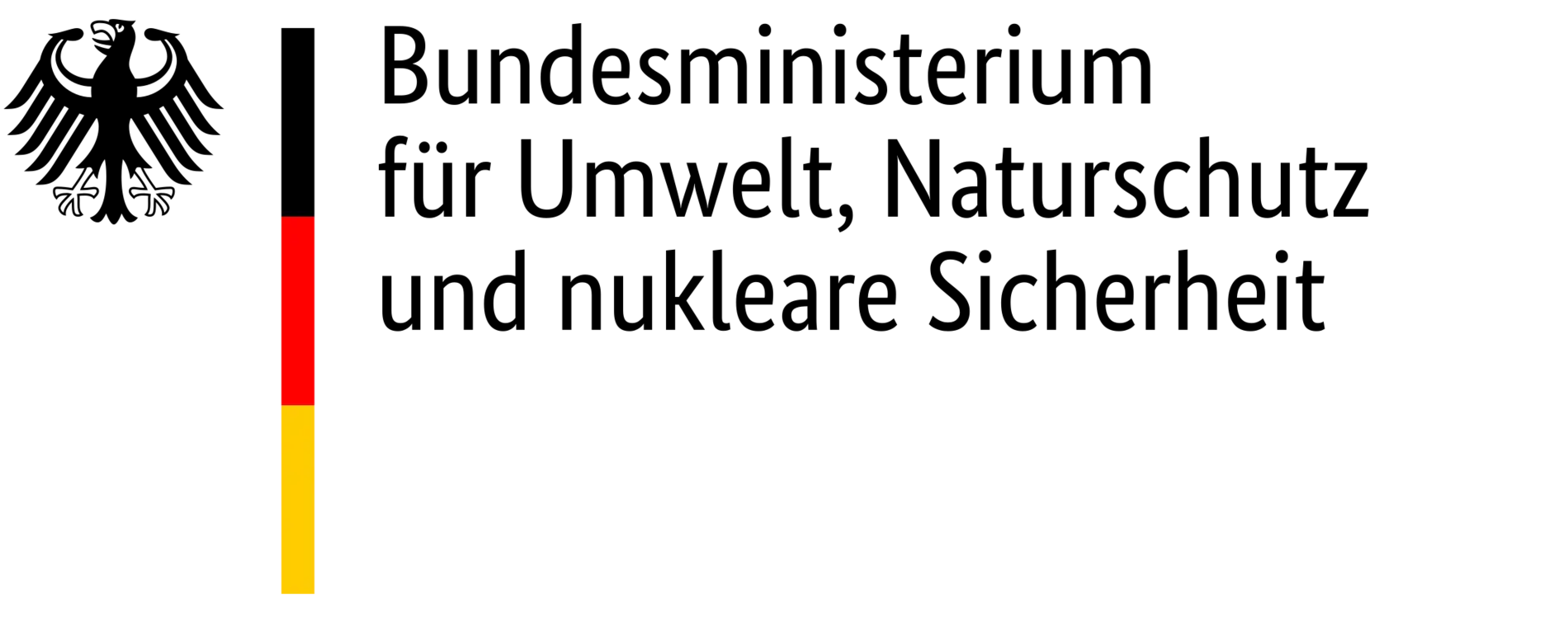
Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) ist Gesellschafterin der BGE und trägt die politische Gesamtverantwortung für das Verfahren. Es beaufsichtigt zudem das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), das wiederum die Arbeitsergebnisse der BGE prüft und außerdem für die Beteiligung der Öffentlichkeit am Standortauswahlverfahren verantwortlich ist.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMUKN (externer Link)

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) übt als Aufsichtsbehörde die Rechtsaufsicht aus, ist Trägerin der Öffentlichkeitsbeteiligung und informiert über das Standortauswahlverfahren. Es prüft die Vorschläge der BGE und stellt zweimal im Verfahren durch Bescheid fest, ob das bisherige Verfahren nach den Regelungen des Standortauswahlgesetzes durchgeführt wurde. Diese Bescheide können Betroffene vor dem Bundesverwaltungsgericht überprüfen lassen. Während des gesamten Verfahrens sieht das Standortauswahlgesetz verschiedene Gremien und Formate vor, über die sich Bürger*innen kontinuierlich an der Endlagersuche beteiligen können. Das sind die Fachkonferenz Teilgebiete, die Regionalkonferenzen und der Rat der Regionen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BASE (externer Link)

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) setzt das Standortauswahlverfahren als Vorhabenträgerin um und betreibt die Schachtanlage Asse II, das Endlager Konrad und das Endlager Morsleben. Außerdem hat sie den Auftrag zur Schließung des Bergwerks Gorleben erhalten. Sie ermittelt über Teilgebiete, Standortregionen und Standorte einen Vorschlag für einen Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle gemäß dem StandAG, erstellt die jeweiligen Erkundungsprogramme, führt Sicherheitsuntersuchungen für potentielle Standorte durch und wird für den Bau und den Betrieb des Endlagers verantwortlich sein. Dabei arbeitet die BGE mit Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zusammen und kann weitere wissenschaftliche Einrichtungen heranziehen.

Das Nationale Begleitgremium (NBG) ist ein unabhängiges, pluralistisch zusammengesetztes gesellschaftliches Gremium. Zwölf von 18 Mitgliedern werden von Bundestag und Bundesrat berufen. Dazu gehören beispielsweise Wissenschaftler*innen, aber auch andere anerkannte Persönlichkeiten, sechs Mitglieder sind zufällig ausgewählte Bürger*innen, die in einem aufwändigen Auswahlverfahren bestimmt werden, zwei davon gehören der jungen Generation an - die Bandbreite der Mitglieder spiegelt die Vielfalt der Gesellschaft wieder. Aufgabe des NBG ist es, die Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle vermittelnd zu begleiten - unabhängig, transparent und bürgernah. Das NBG hat ein umfassendes Akteneinsichtsrecht bei der BGE.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des NBG (externer Link)

Die Fachkonferenz Teilgebiete war das erste formelle Beteiligungsformat im Standortauswahlverfahren. Das Bundesamt für die Sicherheit der Nuklearen Entsorgung (BASE) hat die Konferenz einberufen. Die drei vorgegebenen Konferenztermine zur Beratung des Zwischenberichts Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), der am 28. September 2020 veröffentlicht wurde, sind dann vom BASE unter Beteiligung einer Gruppe bei der Auftaktveranstaltung gewählter Vertreter*innen der Zivilgesellschaft veranstaltet worden. Die Fachkonferenz Teilgebiete fand in der ersten Jahreshälfte 2021 statt.

Das Forum Endlagersuche findet mindestens einmal im Jahr statt. Es ist das Beteiligungsforum für die interessierte Öffentlichkeit zwischen der Fachkonferenz Teilgebiete und dem folgenden formellen Beteiligungsformat, den Regionalkonferenzen, die einberufen werden, wenn die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) die Standortregionen für die übertägige Erkundung vorgeschlagen hat. Die Fachkonferenz Teilgebiete hat die Einrichtung eines Beteiligungsformats für diese Phase des Standortauswahlverfahrens beschlossen. Das Forum Endlagersuche wird vom Planungsteam Forum Endlagersuche (PFE) vorbereitet, in dem das Bundesamt für Sicherheit der Nuklearen Entsorgung (BASE) und die BGE mit vom Forum gewählten Vertreter*innen der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Das erste Forum Endlagersuche fand im Mai 2022 statt, das zweite findet im November 2023 statt.

Zu jeder Zeit ist eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit durch die Bürger*innen vorgesehen. Darüber hinaus sieht das Standortauswahlgesetz Bürger*innendialoge und Bürger*innenversammlungen sowie beispielsweise Regionalkonferenzen vor, in denen sich Bürger*innen am Standortauswahlverfahren beteiligen können.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) war bis April 2017 für die Endlagersuche und den Betrieb der Schachtanlage Asse II, das Endlager Konrad und das Endlager Morsleben zuständig. Heute kümmert sich das BfS im Bereich der ionisierenden Strahlung beispielsweise um die Röntgendiagnostik in der Medizin, die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven Stoffen in der Kerntechnik und den Schutz vor erhöhter natürlicher Radioaktivität. Zu den Arbeitsfeldern im Bereich nichtionisierender Strahlung gehören unter anderem der Schutz vor ultravioletter Strahlung und den Auswirkungen des Mobilfunks.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BfS (externer Link)

Das Standortauswahlgesetz ist im Mai 2017 vom Bundestag beschlossen worden. Am 30. Juni 2020 ist zudem das Geologie-Daten-Gesetz in Kraft getreten. Dieses Gesetz macht die Veröffentlichung der Datenbasis für die Standortauswahl möglich. Der Bundesgesetzgeber ist im Verlaufe des Standortauswahlverfahrens insgesamt dreimal gefordert:
- Am Ende der Phase I ist darüber zu entscheiden, welche Standortregionen oberirdisch erkundet werden sollen.
- Am Ende der Phase II, welche Standorte untertägig erkundet werden sollen.
- Nach der Phase III über den Standort, an dem das Endlager errichtet wird.
Links zum Thema
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (externer Link)
- Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) (externer Link)
- Nationales Begleitgremium (externer Link)
- Öffentlichkeitsbeteiligung - Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) (externer Link)
- Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) (externer Link)








